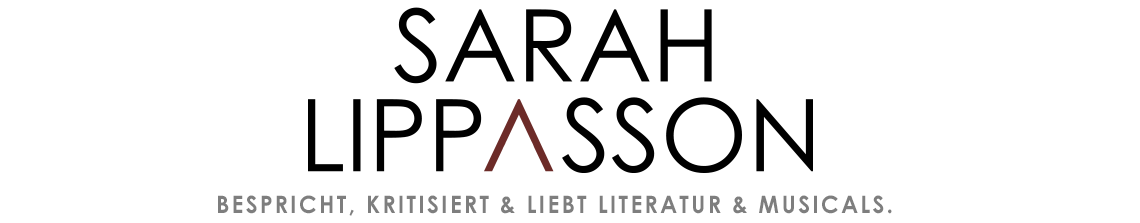Hans Zimmer, Cola, Kaffee und eine Archivarin aus New York
»Ich kenne dich nicht, aber eine Freundin hätte gerne ein signiertes Buch von dir.« So ungefähr verlief das Kennenlernen zwischen Thrillerautor Peter Grandl und mir im März 2023 zur Leipziger Buchmesse, das Peter zum Glück nicht so stehengelassen hat. »Komm mal mit, ich erzähl dir ein bisschen von mir«, sagt er und plötzlich sitzen wir am Stand des PIPER-Verlages und unterhalten uns über seine Bücher, Recherchen, Reisen zu Hans Zimmer und richtig gute Politthriller.
Zwei Bücher, einige Buchmessetreffen und begeisterte Rezensionen von mir später sitzen wir wieder zusammen. Er ist gerade von München nach Neubrandenburg gereist, um abends im Thalia meines Wohnortes zu lesen. Bei Cola, Kaffee und Kuchen kommen wir vorab ins Gespräch – über Deepfakes und Recherchen, die Archivarin der New York Times, Familienschuld und seine Arbeit für die Demokratie.
»Ich arbeite journalistisch mit dem großen Vorteil, dass ich nicht bei der Wahrheit bleiben muss.«
Du hast mit »Reset« ein Buch über Künstliche Intelligenz geschrieben.
Was hast du ChatGPT zuletzt gefragt?
Eine Freundin von mir hat sich zwei Wochen nach ihrer Hochzeit unglücklich in einen anderen verliebt und mir erzählt, dass sie das mit ChatGPT besprochen hat (lacht). Da habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal mit ChatGPT reden. Es ist wirklich beängstigend, wie die App versucht, menschliche Regungen nachzuahmen. Es regt aber auch vollkommen auf, weil sie ständig alles wiederholt. »Jetzt mal ganz locker und auf den Punkt«, sagt sie bei praktisch jedem Einleitungssatz.
Wahrscheinlich war das Letzte für meine Recherche zum neuen Buch. Irgendwas über den Vatikan. Ich mag, dass ich bei ChatGPT Dinge hinterfragen und Antworten bekommen kann, die deutlich komplexer sind und Recherchen aus aller Welt umfassen.
Hast du dann einen Roman über KI mit der KI geschrieben?
Nein, erst für meinen neuen Roman habe ich mit der KI recherchiert. Zum Zeitpunkt von »Reset« gab es das noch nicht. Da habe ich klassisch gegoogelt oder Menschen gefunden, die meine Fragen beantwortet haben. Zusätzlich recherchiere ich natürlich aber immer noch wie ein Journalist. Ich sage dazu, ich arbeite journalistisch mit dem großen Vorteil, dass ich nicht bei der Wahrheit bleiben muss. Ich habe kreative Freiheiten und kann Ausreißer machen.
Zum Beispiel bei der Sache mit dem Flugzeug am Anfang meines Romans. Aktuell findet der Flugfunk noch analog statt. Man kann ein Flugzeug also gar nicht digital hacken, weil da keine entsprechenden Verbindungen sind. Aber das Flugzeug nutzt Verschlüsselungen, die natürlich digital sind. Daraus zu schlussfolgern, dass diese Verbindungen reichen, um eine Nachricht inklusive Ton und Bild an den Bordcomputer zu senden, ist komplette Fiktion. Gleichwohl kann der Funk direkt am Flughafen gestört werden.

Peter Grandl,
geboren 1963, begann seine Karriere als Filmregisseur für Kino und TV. Danach wechselte er in die Werbebranche, wo er bis 2022 als Creative Director für namhafte Kampagnen verantwortlich war.
Sein Debütroman, der gesellschaftskritische Thriller Turmschatten, wurde 2020 zu einem Überraschungserfolg. 2024 adaptierte Paramount Turmschatten als Streaming-Serie. Auch die beiden folgenden Thriller, Turmgold und Höllenfeuer, fanden große mediale Beachtung. 2025 erscheint sein neuer Thriller Reset im dtv-Verlag.
»Es könnte durchaus passieren, dass meine Enkelkinder nicht mehr in einer Demokratie leben.«
Du hast mal gesagt, deine Bücher fangen mit einem »Was wäre, wenn …?« an. Wie ging das bei »Reset«?
Ich glaube, es ging so: Was wäre, wenn wir keiner einzigen Nachricht mehr trauen können? Weil ich denke, dass wir viel zu wenig darüber nachdenken, wie abhängig und lebenswichtig Nachrichten sind, denen wir vertrauen können. Wenn unser Nachrichtensystem in jeglicher Form zusammenbricht, dann haben wir nur noch den Menschen, der uns gegenüber sitzt. Alles, was sonst passiert, wäre potenziell gefaked. Es reicht ja sogar, wenn eine von zehn Nachrichten Fake ist, dann glaubt man den anderen neun auch nicht. Das ist im Augenblick die größte Geisel der Menschheit. Jeder Mensch hat einen Trigger, man muss ihn nur finden und dann regt er sich auf und das vielleicht ganz umsonst.
Das impliziert möglicherweise auch Handlungen – beispielsweise, dass ich anders wähle. Oder dass ich irgendwelche Ausländer verurteile. Aber letztendlich kann ich über Nachrichten unser komplettes Wertesystem ausheben, viel besser als über Schusswaffen. Bei Schusswaffen gibt es Verbote, die auch strenger werden. Aber Nachrichten können ganz einfach manipuliert werden.
Du hast Bücher geschrieben über rechtsextreme Strukturen, eines über islamistische Strukturen. Wie kam es dann zu »Reset«?
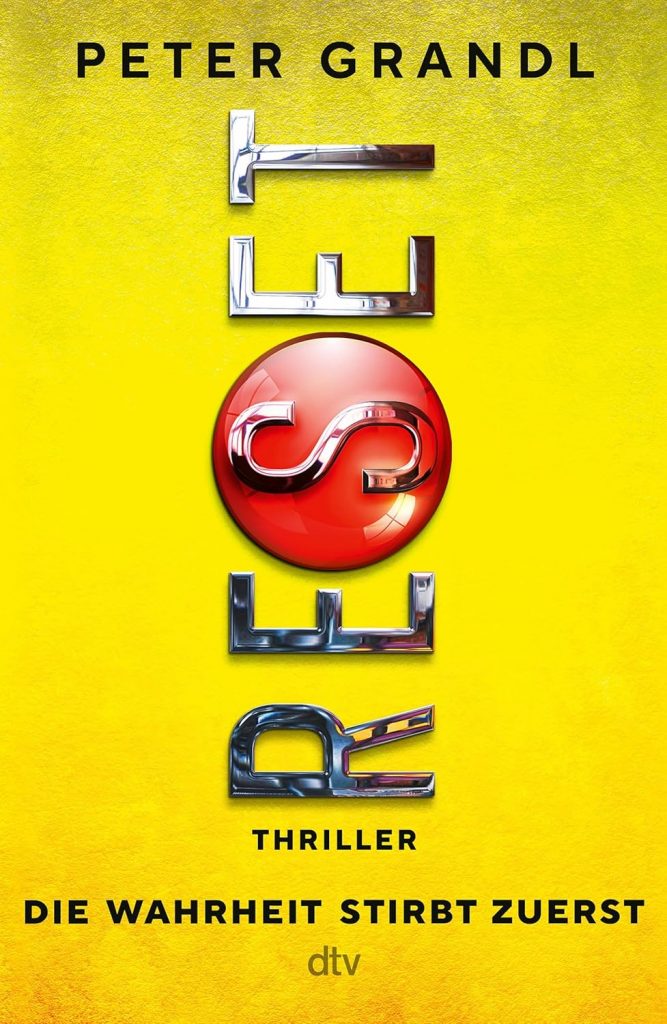
Ich habe vier Bücher über die Gefahren für unsere Demokratie geschrieben. Sie greifen unterschiedliche Ausprägungen dieser Gefahren auf – von Rechtsextremismus über Islamismus bis hin zu digitalen Bedrohungen. Es sind immer unterschiedliche Ansätze, aber der Kern ist der Wertverlust, der beginnt, wenn wir uns irgendeiner dieser Gefahren nicht bewusst sind und hingeben – dann bricht die Demokratie zusammen. Und dann haben wir morgen vielleicht nicht mehr das, was wir heute genießen. In »Reset« verschiebe ich die Bedrohung in die digitale Ebene: Wenn nicht mehr sicher ist, ob eine Nachricht echt ist – ein privater Anruf, eine Nachrichtensendung, ein Video – dann ist das Vertrauen zerstört. Das ist eine neue Variante des Angriffs. Es geht immer um den Status Quo und die Frage, was ist, wenn er ins Wanken gerät. Das sehe ich aktuell an allen Ecken und Enden. Es könnte durchaus passieren, dass meine Enkelkinder nicht mehr in einer Demokratie leben.
Macht dir das Angst?
Total. Ich will nicht, dass Angst lähmt, sondern wach macht. Was mich besonders erschreckt, ist die Gleichgültigkeit vieler gegenüber dem, was uns hier schützt: Meinungsfreiheit, unabhängige Justiz, Pressevielfalt. Wenn dann Menschen, die in Deutschland alle Freiheiten genießen, ausgerechnet einen Autokraten wie Erdoğan feiern und gleichzeitig unser Wertesystem kritisieren, dann läuft etwas gewaltig schief. Hermann Hesse hat gesagt: »Wir erkennen das Paradies erst, wenn wir daraus vertrieben wurden.« Das passiert gerade. Wir motzen so viel und erkennen die Vorteile gar nicht, die wir genießen. In meinem Roman »Höllenfeuer« geht es um Datenschutz – was passiert denn, wenn wir die persönlichen Daten jedes Einzelnen so hoch wahren, dass sich Kriminelle und Extremisten dahinter verstecken können.
Zum Beispiel wurde vor etwa einem halben Jahr, am 15. März 2025, ein Gesetz beschlossen, das sogenannte polizeiliche Gefährder, die abgehört werden, schützt. Kontakte von Personen, die bereits als Gefährder überwacht werden, dürfen aus Datenschutzgründen nicht mehr automatisch mit abgehört werden, selbst wenn diese in konspirative Telefonate verstrickt sind. Dieser Einschnitt sendet eine deutliche Botschaft: Je mehr wir solche Einschränkungen zulassen, desto stärker werden informelle Netzwerke und verdeckte Manipulation unsere Demokratie untergraben.
Ich muss gerade an meine Schwester denken, die für ein Jahr in Korea lebt. Dort wird man überall mit Sicherheitskameras überwacht.
Das ist halt das andere Extrem. Die Frage ist immer, was ein Staat zugestehen kann. Auch in Deutschland ist im öffentlichen Raum ja vieles überwacht. Ich habe für »Höllenfeuer« mit Kriminalbeamten zu tun gehabt, die sogenannte Gefährder überwachen. Eine Oberregierungsrätin hat mir erzählt, dass sie erst in die Nachrichten einschaltet, wenn sie im Büro ist. Sie könnte es nicht ertragen, wenn einer ihrer Gefährder auftaucht und sie nichts tun kann, weil sie etwa bei der Familie oder in der Bahn ist und keinen Zugriff auf die polizeilichen Systeme hat.
Das zeigt, wie groß die Verantwortung ist – aber auch, wie begrenzt die Mittel. Sicherheit darf nicht naiv gedacht werden – weder mit dem Ruf nach totaler Überwachung noch mit reflexhaftem Datenschutz an der falschen Stelle.

Da merkt man direkt, dass deine Figuren auf realen Vorbildern begründet sind. Die Oberregierungsrätin kommt mir aus »Höllenfeuer« bekannt vor.
Was war das Brisanteste, das du jemals recherchiert hast?
Das waren Dinge, die in der Vergangenheit lagen, aber hochaktuell sind. Gerade bei »Turmschatten« gibt es Geschichten, etwa wie weit die Wehrsportgruppe Hoffmann schon war. Sie hatten bis zu ihrem Verbot 1980 bereits achtzehn Laster voller Waffen, Sprengstoff und Propagandamaterial, die sichergestellt wurden. Sie waren kurz davor, die bayerische Regierung zu putschen und sich als Kameradschaft Süd neu zu organisieren. Das ging deutlich über rechte Gesinnung hinaus – da standen wir an der Schwelle zu bürgerkriegsähnlichen Szenarien. Und das zu einer Zeit, zu der wir alle nicht viel darüber nachgedacht haben. Später kam dann die NSU-Sache. Immer eigentlich Dinge, die von rechter Seite im Untergrund laufen – wie sie sich organisieren, zurückziehen, neue Wege finden. Als Kameradschaft können sie auch schwer verboten oder belangt werden, weil diese Form sie juristisch schützt.
»Das ist schon ein bisschen Schwarzenegger!«
Eine weitere Recherche war die über einen Quick Reaction Piloten (QRA). Wie lief das ab?
Für »Reset« bin ich in Kontakt mit verschiedenen Behörden getreten. Unter anderem mit der BSL, der speziellen Abteilung der Bundespolizei, die für den Einsatz von Air Marshals in Zivilflugzeugen zuständig ist. Aber auch mit der Bundeswehr war ich im Austausch, denn ich wollte verstehen, wie sogenannte QRA-Einsätze funktionieren – also das schnelle Aufsteigen von Abfangjägern, wenn ein Flugzeug in der Luft zur Bedrohung wird. Je bekannter ich wurde, desto einfacher wurde es. Leute konnten mich googlen, meine Interviews in überregionalen Zeitschriften, meine Bücher.
Meist gingen die Empfehlungen durch diverse Stellen und Generalstäbe. Sie haben mich zurückgerufen, es ging über verschiedenste Sicherheitsfreigaben, bis es hieß: Da ist ein Pilot in Neuburg an der Donau, der bereit wäre, mit Ihnen zu sprechen!
»Die Menschheit benötigt dringend einen Reset.« So heißt es hinten auf deinem Klappentext. Glaubst du das auch?
Nein, das ist nur ein Gedankenmodell, ein Experiment. Wenn wir – und sei es nur für zwei Wochen – wieder in dieser analogen Welt leben würden. Ich glaube, das würde auch zu einem Erwachen führen. Das ist wie Menschen, denen man sagt, sie sollen zwei Wochen keinen Zucker essen. Nach zwei Wochen fühlen sie sich besser. Es soll auch wieder sensibilisieren für den Umgang mit digitalen Medien. Aktuell sind wir wie kleine Kinder, die alles haben wollen, was glitzert und toll aussieht. Das ist in meinen Augen schadhaft. Ich wünsche mir mehr Sensibilität für digitale Welten.
Wir hatten es über den Quick Reaction Piloten. Magst du von anderen realen Vorbildern in »Reset« erzählen?
Es gibt zum Beispiel den Vorsitzenden des Funkamateur-Verbandes. Sie haben weltweit Kontakte nach Russland, China, rund um die Welt. Unabhängig von Social Media oder anderen Beschränkungen. Die Welt spricht da zusammen, ungeachtet von Grenzen und Auflagen. Sie werden am Ende auch genannt, weil sie die Lösung für den gesamten Roman waren. Ich wollte ja, dass die Menschheit kommuniziert, aber eben analog.
Genauso auch Seiko aus Japan, die ich über meine Community via Instagram kennengelernt habe. Da habe ich lange gesucht, bis ich die richtige gefunden habe. Es musste eine jüngere Person sein, die sowohl in Deutschland als auch in Japan lebt. Sie hat mir viel über die japanische Lebensweise und das Leben in Japan mit Generationskonflikten erzählt. Wir haben auch über die deutlichen Unterschiede zur Frauenbewegung in Europa gesprochen. Als sie nach Deutschland zum Studium kam, war das ein Culture Clash.
Während meiner Japan-Recherchen erfuhr ich aber zum Beispiel auch von Enjokōsai – einem Phänomen, das man am ehesten als „bezahlte Begleitung von Schulmädchen“ übersetzen könnte. Eine Gesprächspartnerin erzählte mir, dass manche Mädchen mit Preisschildern um den Hals durch bestimmte Stadtviertel laufen. Wer den Preis zahlt, darf mit ihnen essen gehen, spazieren oder Zeit verbringen. Offiziell ist das keine Prostitution – aber die Grauzonen sind offensichtlich. Es existiert eine gesellschaftliche Doppelmoral, bei der vieles toleriert oder beschönigt wird, solange es nicht offen ausgesprochen wird.
Diese Mentalität begegnet einem auch in der Popkultur: Manga- und Anime-Charaktere tragen oft extrem kurze Schuluniformen – eine Ästhetik, die sexualisierte Jugendlichkeit normalisiert. Für mich war das ein spannender, aber auch verstörender Einblick in ein Land, das technologisch hochmodern ist, aber gleichzeitig in manchen sozialen Fragen erstaunlich konservativ oder widersprüchlich agiert.
Mich interessieren nicht nur die großen politischen Dinge, sondern auch die kleinen, persönlichen Geschichten. Deshalb ist Seiko im Buch sehr ruhig, schüchtern, zurückhaltend, aber auch einsichtig. Die japanische Mentalität hat weniger Ego. Ich kenne viele Menschen – vielleicht gehöre ich sogar selber dazu – , die sich nur schwer Fehler eingestehen. Das war im Gespräch mit ihr spannend.

Ergibt sich dann aus deiner Recherche die Geschichte?
Nee, ich mache erst die Geschichte. Ich habe immer banale Vorstellungen und versuche dann, diese Annahmen zu bestätigen. Zum Beispiel waren mir das Ausmaß und die Verbreitung vom Amateurfunk nicht bekannt; mir wurde von einem Experten Geschichten selbstgebauter Satelliten in Milchtüten-Größe erzählt, die im Weltraum schweben und Signale senden. Das war faszinierend und damit wurde dieses Detail für die Geschichte wichtiger.
Aktuell klüngel ich mit Genforschern. Auch da stoße ich an Grenzen: Was ich mir für meine aktuelle Geschichte überlegt habe, sei »zu weit weg von der Realität«, sagen sie. Aber genau das macht die Zusammenarbeit spannend. Dann bitte ich sie, mir dabei zu helfen, dass es glaubwürdiger wird. Das ist dann auch eine spannende Herangehensweise.
Und wenn du auf große Fragen mal keine Antworten findest?
Dann wird die Geschichte umgeschrieben. Fiktion setzt sich auf die Realität, nicht umgekehrt. In »Höllenfeuer« hatte ich eine Verfolgungsszene in der Kanalisation von München geplant. Mir wurde dann erklärt, dass sich die gesamte Kanalisation bei Regen innerhalb weniger Minuten bis zur Decke mit Wasser füllt. Logischerweise hat es in meinem Thriller angefangen zu regnen, als mein Held in der Kanalisation einen Terroristen jagte. Unter wahnsinnigen Bedingungen überlebt meine Figur dann – das ist schon ein bisschen Schwarzenegger. Aber wenn es dramaturgisch funktioniert und halbwegs plausibel ist, dann darf Fiktion auch mal mutig sein.
»Meine Großeltern waren überzeugte Nationalsozialisten.«
Deine liebste Figur aus »Reset« ist Jill, Gesellschafterin und Archivarin der New York Times, stimmt’s?
Ja, ich mochte den Gedanken der Archivarin. Dass es immer jemanden gibt, der diese ganzen analogen Medien hält und auf Negative und Filme achtet. Die sind sehr viel langlebiger als die digitalen Daten. Man kann Filme heute komplett neu produzieren und restaurieren aus altem Material. Ich mochte auch, dass Jill so eine romantische Vorstellung hat und in der Krise vorschlägt, die Zeitung auf gedrucktem Papier zu veröffentlichen. Es ist auch da eher Fiktion, weil relativ ausgeschlossen ist, dass so viele Menschen eine analoge Zeitung produzieren könnten.
Ich mochte, wie sie die alten Maschinen aus dem Museum geholt haben.
Da habe ich zum Beispiel Charlie Smoke kennengelernt, der bei der Augsburger Allgemeinen arbeitet und eigentlich Karl Rauch heißt. Ich konnte natürlich nicht alle alten weißen Männer der New York Times persönlich treffen, aber ich kannte die Verlegerin der Augsburger Allgemeinen. Sie hat es möglich gemacht, dass ich mit ehemaligen Mitarbeitenden sprechen konnte, die längst im Ruhestand waren – darunter eben auch Karl Rauch. Aus ihm wurde schließlich die Figur Charlie Smoke. Jill selbst ist hingegen reine Fiktion.
Ich muss bei ihr immer an Meryl Streep und »Der Teufel trägt Prada« denken.
Ich bin mal gespannt auf die Verfilmung. In meinen Augen ist es immer Kristin Scott Thomas (lacht).

Du hast vorhin erzählt, dass du in deinem Keller schreibst, dort nur den hellen Bildschirm vor dir. Und dass du dann manchmal in ein dunkles Loch fällst …
Ja, das war vor allen Dingen bei der Turm-Dilogie so. Gerade da habe ich viel in der eigenen Familie recherchiert. Ursprünglich sollte es ein Buch meines Großvaters mütterlicherseits sein – ein Förster, der sich zum überzeugten Nationalsozialisten entwickelte und das auch nach dem Krieg nie abgelegt hat. Die Recherchen in den Bundesarchiven haben mir immer mehr über meine eigene Herkunft offenbart – über Generationen hinweg.
Wenn ich heute in Schulen lese, werde ich oft gefragt, ob ich selbst jüdisch sei. Dann sage ich: Nein, aber meine Großeltern waren überzeugte Nationalsozialisten. Sich dazu zu bekennen, dass wir nicht alle Mitläufer oder im Widerstand waren, halte ich für wichtig. Mein Großvater erklärte mir auch immer, dass die Juden an unserem Unglück schuld seien – und ich habe ihm geglaubt, als Kind zumindest. Erst später habe ich angefangen, das zu hinterfragen – und ab da auch dagegen zu arbeiten, was in meiner Familie zu persönlichen Konflikten geführt hat.
Arbeitest du die Familienschuld auf?
Ja, sicher. Ich sehe das als Teil meiner persönlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und ich habe auch ganz konkret vor, ein Buch über meinen Großvater zu schreiben. Das Buch soll auch seinen Familiennamen tragen.
Wir hatten es vorhin über »Stella« von Takis Würger und mich reizt ein ähnlicher Ansatz: die Geschichte aus der Perspektive eines Mannes zu erzählen, der als Familienvater und Förster aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt – und dann im Löwenbräukeller eine Rede von Hitler hört.
. Wir haben ja im Vorfeld unseres Gespräches schon darüber gesprochen, wie sehr Reden dazu beitragen können, einem Wahn oder einer Überzeugung zu verfallen. Ich würde gerne den Versuch wagen, die Verführung nachzuzeichnen – aus der Sicht eines Täters. Und was das Ganze für mich so schwer, aber auch erzählenswert macht: ich habe meinen Großvater ja noch kennengelernt, habe meinen Opa geliebt über alles, ein ganz toller Familienmensch.
Wie bist du damit umgegangen, als du das alles erfahren hast?
Mein Opa war bereits tot, als ich mit der Recherche begonnen habe. Aber je mehr ich gelesen habe, desto mehr konnte ich nachvollziehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ich wollte verstehen, nicht verharmlosen – und gerade weil ich verstehen wollte, wurde mir klar: Wir stehen heute wieder an einem Punkt, an dem vieles in eine ähnliche Richtung driftet. Ich verurteile das entschieden – aber ich kann nachvollziehen, wie Menschen in solche Denkmuster geraten.
Irgendwann habe ich sogar gemerkt, dass ich meinen Großvater innerlich in Schutz nehme. Er war komplett ideologisch durch die Mangel gedreht worden – über Jahre. Und wenn man das verinnerlicht hat, wenn man tief überzeugt ist, dass ein Mensch mehr wert ist als ein anderer, dann ist das nicht nur ein Irrglaube, sondern ein systematisch anerzogener.
Diese Erkenntnis hat mir geholfen, mit ihm Frieden zu schließen. Nicht, weil ich seine Haltung akzeptiere – sondern weil ich verstanden habe, woher sie kam.

»Es hat mir nie Spaß gemacht, in der Werbung zu sein.«
Aktuell recherchierst du über den Vatikan.
Auch. Aber auch über Wunder, Genforschung, Glauben, Jesus und Religion.
Ich denke da an »Sakrileg«. »Konklave«.
Ich würde es keinesfalls in diese Richtung schieben. Es ist wieder ein Sachbuch, das eine spannende Geschichte erzählt. Aber ich versuche, so nah wie möglich, die Konflikte der Kirche aufzugreifen. Das ist geprägt von Machterhaltung, andererseits interessiert sich kein Mensch mehr für die Kirche. Meine Frage ist daher: Verlieren wir etwas, wenn wir unseren Glauben verlieren? Nietzsche sagte: »Gott ist tot«. Womit gemeint war, dass die Wissenschaft Gott umgebracht hat. Kein Mensch glaubt mehr an die Entstehungsgeschichte in sechs Tagen und am siebten Tag ruht Gott. Aber die Frage ist, ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir dieses göttliche Element aus unseren Seelen schneiden und durch Wissenschaft ersetzen. Genau dieser Widerspruch interessiert mich. Und daraus entsteht – ganz ohne Dan Brown zu imitieren – ein Thriller im Umfeld der Kirche, aber mit einem neuen Ansatz.
Und wie sieht die Recherche aus?
Natürlich will ich in den Vatikan und dort einen Ansprechpartner finden. Ich möchte mit sehr gläubigen Menschen aus dem Klerus reden und ich möchte auch mit Atheisten sprechen.
Ich arbeite aktuell mit zwei Genforschern aus Regensburg zusammen – der wissenschaftliche Teil ist also gut abgedeckt. Schwieriger ist es mit dem Vatikan: Ich suche händeringend nach verlässlichen Insiderkontakten. Ein deutscher Vatikan-Experte hat mir kürzlich klargemacht, dass er mich nur unterstützt, wenn er als Co-Autor genannt wird … also suche ich weiter.
Du darfst eine Botschaft an die Verlags- und Leser:innenwelt senden. Welche ist das?
Die größte Lüge unserer Zeit lautet »Be yourself«. Ich war lange im Marketing und diese Botschaft verpackt sich in jeder erdenklichen Werbenachricht. »Mit unserer Marke, unseren Klamotten kannst du endlich du selbst sein …« In meiner Welt mache ich eine unglaubliche Entwicklung, habe Vorbilder, will mich wandeln, etwas sein, bin Schüler und will kein Egoist sein. Ich finde, es ist falsch, so zu denken. Es ist auch verlogen, weil alle diesen Kommerz aufsitzen. »Be you« ist eine Kosmetikmarke, obwohl man sich ja doch anmalt (lacht). Es wird Zeit, dass wir aufhören, Selbstverwirklichung mit Selbstfixierung zu verwechseln.
Aber du weißt doch, wie die Industrie läuft. Ist das Frust?
Nein, nein. Werbung ist per Definition immer ein Stück Inszenierung. Man verpackt eine Botschaft so, dass sie besser wirkt – oft zugespitzter, schöner oder klarer als die Realität. Ich habe diesen Job gemacht, weil mir Kreativität irgendwie in den Schoß gefallen ist und ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen konnte.
Aber es war nie so, dass es mir wirklich Freude gemacht hätte. Am Ende kommt ein Hersteller und sagt: „Mach mein Produkt spannender als die neun anderen, die es schon gibt.“ Das ist ein Spiel, das man eine Zeit lang mitspielt – und dann merkt man, dass es Zeit für etwas anderes ist.
Ich habe dann begonnen, mich Projekten zu widmen, die mir wirklich etwas bedeuten. Ich war in den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern, habe einen Film über häusliche Gewalt an Kindern gemacht – und irgendwann begann ich zu schreiben. Das war der eigentliche Wendepunkt.
Du hast das Unbequeme gesucht?
Das Befriedigende. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben, weil mir das in einer bestimmten Phase meines Lebens Kraft gegeben hat – um den ganzen beruflichen Nonsens, den ich damals noch machen musste, überhaupt auszuhalten. Schreiben war für mich nie Eskapismus, sondern ein Gegenpol. Etwas, das Substanz hatte. Etwas, das bleibt.
Ihr seid neugierig geworden und möchtet ein Buch von Peter Grandl lesen?
Einen Überblick seiner Werke findet ihr hier: